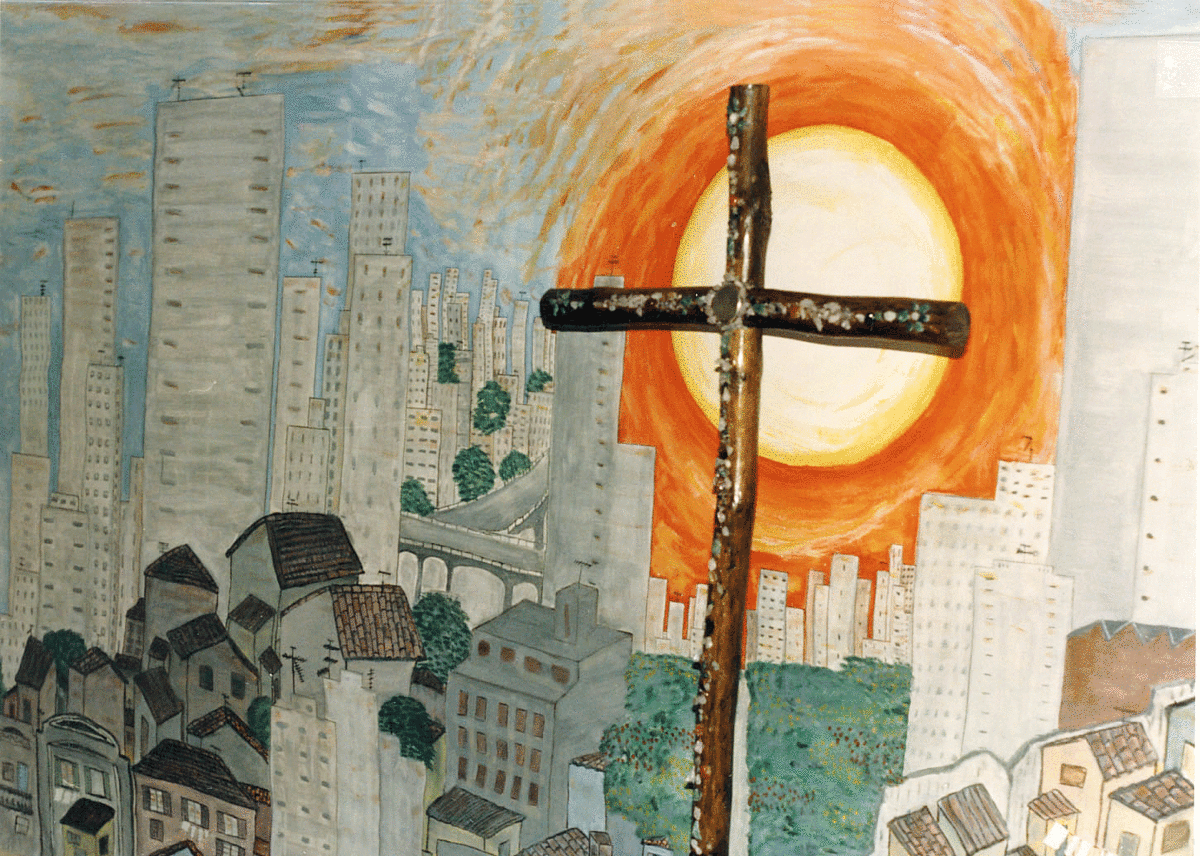»Was willst du von mir? - O que você quer de mim?«
»Wie wurdest du zum ersten Mal auf die Scalabrini-Gemeinschaft und auf das Leben von Bischof Giovanni Battista Scalabrini aufmerksam?« Diese Frage stellten wir Christiane, sie gehört zu unserer Gemeinschaft und lebt im IBZ Scalabrini in Solothurn.
Bevor ich darauf antworte, möchte ich zuerst einmal allen danken, die mir von Anfang an und bis heute zeigen, wie lebendig die scalabrinianische Spiritualität ist – auch für unser Leben als Missionarinnen.

Ich komme aus Deutschland, genauer gesagt aus Ingolstadt, nördlich von München in Bayern. Meine Eltern mussten als Jugendliche selbst im 2. Weltkrieg alles zurücklassen und mit ihren Familien eine neue Heimat suchen. Das wurde mir aber erst viel später bewusst.
Während meines Studiums der Sozialpädagogik und der Theologie besuchte ich eine Tagung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Damals war es in diesen Veranstaltungen noch nicht so selbstverständlich, Teilnehmende aus anderen Ländern anzutreffen. Aber dort war eben eine Scalabrini-Missionarin aus Italien dabei. Wir lernten uns kennen, und sie lud mich zu einem internationalen Treffen junger Leute im »Centro di Spiritualità« in Stuttgart ein. Ja, und dorthin bin ich dann zum Ostertreffen gefahren.
An was erinnere ich mich noch? Was hat mich fasziniert? Vor allem die Gemeinschaftserfahrung, der Tiefgang, mit dem wir diese Tage gelebt haben – obgleich wir an Sprache und kulturellem Hintergrund so verschieden waren. Und auch die Herzlichkeit und Unkompliziertheit von P. Gabriel Bortolamai. Er leitete die Tage.
Auch die Begegnung mit Migranten machte mich betroffen. Sie lebten in den Hinterhöfen unserer schönen Städte. Und da sah ich zum ersten Mal die Armut in meinem eigenen Land. Gleichzeitig erlebte ich die Großherzigkeit und Opferbereitschaft dieser Menschen, ihren inneren Reichtum. Das trieb mich um, und ich wollte etwas tun, mich engagieren … Und dann kann ich mich besonders an die Osternacht erinnern. Dieser Gott, der in Jesus bis zum Äußersten gegangen ist, der uns Vater ist, Vater eines jeden Menschen. Und ich fühlte die Frage aus dem Johannes-Evangelium an mich gerichtet: »Liebst du mich?« (vgl. Joh 21,15). Ich war aber nicht bereit, ja zu sagen, alles zurückzulassen und mein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Die Frage brannte in mir, aber ich sagte »nein« und ging weg – weit weg.
Zuerst führte mich mein Weg für ein Jahr nach Israel, um für mein Studium der Sozialpädagogik ein Praktikum zu machen. Dort arbeitete ich in einer Schule mit palästinensischen Kindern, viele davon aus einem nahegelegenen Flüchtlingslager. Gleichzeitig setzte ich mein Studium der Theologie fort. Für mich waren immer beide Bereiche wichtig: Konkret Mitanpacken und das Staunen vor dem Großen, die direkte Begegnung mit den Menschen und die großen Fragen im Leben: Warum das alles? Was steht hinter jedem Menschen?
Wieder in Deutschland engagierte ich mich im Sozialbereich. Zusammen mit Freunden war ich in einem Eine-Welt-Laden tätig. Politisch war ich eher links orientiert. Ich war mit Tausenderlei beschäftigt und hatte viele Zukunftsträume. Das Kapitel »Ostern in Stuttgart« war inzwischen abgehakt.
Nach dem Studium fehlte es nicht an Möglichkeiten. Aber ich suchte nach etwas, um mich gegen das Unrecht in der Welt einzusetzen, etwas Authentisches, das meinem Leben einen Sinn und eine Antwort auf meine vielen Fragen geben konnte.
Heute – im Rückblick – entdecke ich, dass mich dabei zwei Bischöfe begleiteten – auch wenn ich damals für Bischöfe als Kirchenvertreter keine großen Sympathien hegte. Der eine ist Giovanni Battista Scalabrini, der andere Oscar Romero, ein Märtyrer aus El Salvador. Er begleitete mich schon eine Weile auf meinem Lebensweg. Als er nämlich erschossen wurde und ich als Jugendliche von seinem Tod hörte, fragte ich mich: Warum geht ein Mensch so weit? Warum lässt er sich für sein Volk umbringen? Was hat ihn angetrieben?
Nach dem Studium ergriff ich die Gelegenheit, einen Jugendtraum wahr werden zu lassen. In einer nahegelegenen Pfarrei suchte man jemanden, der beim Aufbau einer Partnerschaft mit einer Basisgemeinde in Brasilien mithelfen könnte. Das war meine Chance – und vor allem wollte ich nach Lateinamerika! Die Befreiungstheologie, Boff, Dom Helder Camara, Arns, Ernesto Cardenal begeisterten mich. Und so erreichte ich Natal im bitterarmen Nordosten dieses riesigen, faszinierenden Landes.

Gewalt, Hunger, Not, Krankheiten, Tod … das gehörte zum Alltag der Favela namens Mãe Luiza. Gleichzeitig erlebte ich Menschen, die aus der Hoffnung lebten, die nicht aufgaben, um ihr Leben kämpften und einen unkomplizierten und authentischen Glauben praktizierten. Im Aufschrei dieser Menschen entdeckte ich den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Erneut taten sich viele Fragen in mir auf: Warum bin ich nicht zufällig hier auf die Welt gekommen, sondern in Deutschland, in einer liebevollen Familie? Wo ist mein Platz im Leben? Was ist meine Aufgabe? … Dieses Jahr hat mich zutiefst geprägt, ja, total aufgewühlt.
Während meines Aufenthalts kam ich auch nach São Paulo. Ich wollte einige Projekte kennen lernen, die sich um Migranten aus dem Nordosten Brasiliens und um Straßenkinder kümmerten. Als ich nach drei Tagen und Nächten im Bus in der Metropole ankam, feierte man gerade den »Tag des Migranten«. Eine Demonstration von Straßenkindern, Obdachlosen und Armen zog sich durch die Straßen vorbei an Wellblechbaracken und Cortiços, luxuriösen Wolkenkratzern und bewohnten Kartonschachteln. Die Leute sangen und hielten Transparente in den Himmel. Und wer war mittendrin?: einige Scalabrini-Missionarinnen. Seit unserem letzten Treffen waren sieben Jahre vergangen. Das hatte ich wirklich nicht erwartet.
Drei Tage blieb ich bei ihnen und fühlte mich wie zuhause – in der kleinen Wohnung inmitten der Cortiços. Ihre Präsenz war wie ein winziger Tropfen im Ozean dieser riesigen Stadt. Es waren nicht die gleichen Missionarinnen, die ich aus Stuttgart kannte, aber es war die gleiche Gemeinschaft – auf der anderen Welthalbkugel. War auch die Umgebung eine ganz andere, der Kern war der gleiche. Das hat mich beeindruckt und gleichzeitig auch durcheinandergebracht. Aber nach drei Tagen erneuerte ich mein »Nein« und reiste ab Richtung Foz de Iguaçu. In São Miguel war ich zu Gast bei den Ingolstädter Franziskanerinnen. Ich bewunderte nicht nur die weltberühmten Wasserfälle, ich begleitete die Schwestern auch auf eine Demonstration landloser Bauern. Und während wir auf den Lastwagen warteten, der uns in die nächste Stadt bringen sollte, schaute ich mir die kleine Dorfkirche an. Und was fand ich dort? Scalabrini – auf einem riesigen Plakat! Wieder war ich total überrascht, und ich stellte mich davor und fragte: «O que você quer de mim? -Was willst du von mir!?«
Kurz darauf kam der Pfarrer und als er hörte, dass ich Deutsche bin, rief er voll Freude: »Ich bin Scalabrini-Missionar und habe einen Bruder, der lebt in Stuttgart, P. Gabriel!«. Ich wusste noch sehr wenig über Scalabrini, aber »er« scherzte schon mit mir!
Bevor ich nach Europa zurückkehrte, besuchte ich noch einmal São Paulo und lebte zwei Wochen mit den Missionarinnen – auch um sie etwas besser kennen zu lernen. Was bleibt mir aus diesen Tagen in Erinnerung?
Ihr unermüdlicher Einsatz für Migrantinnen und Migranten. Sie kümmerten sich um die Menschen von der ersten Begegnung an, sie waren aber auch in der Sensibilisierung aktiv, damit sich auf gesellschaftlicher und politischer Ebene etwas verändern würde. Sie fungierten als »Brückenbauerinnen« zwischen Reichen und Armen, Einheimischen und Neuangekommenen, Menschen unterschiedlichster Herkunft und Situation.
Mich faszinierte auch die scalabrinianische »Spiritualität des Exodus«, das heißt, wie die alltäglichen Geschehnisse interpretiert wurden. Oft ging es dabei im Leben der Migranten um schockierende Ereignisse. Aber darin wurde nicht nur das Problem gesehen und behandelt, sondern auch nach der Chance gesucht, die sich dahinter verbergen konnte. Der Apostel Paulus spricht von der Welt, die in Geburtswehen liegt – und in diesem Sinne gingen die Missionarinnen die Herausforderungen an.
Ihr einfacher Lebensstil, die Kreativität mit der sie Neues und Unvorhergesehenes angingen und vor allem ihre spürbar tiefe Beziehung zu Christus sprachen mich an. Und dieselben Missionarinnen, die ich tagsüber in die Favelas, zu den Familien, in die Ämter und unter die von Armen besiedelten Brücken begleitete, die traf ich abends in der Stille der Kapelle vor der Eucharistie wieder. Da fand ich auch die Antwort auf meine Frage: Woher sie wohl die Kraft für ihren Einsatz nehmen …?

Es war einer meiner letzten Tage in São Paulo, ich ging zum Gottesdienst in die Kathedrale. An diesem Tag feierte man das zehnjährige Gedächtnis für Oscar Romero. Die riesige Kirche war bis auf den letzten Stehplatz gefüllt: alles Menschen von der Straße, Kinder, Obdachlose, Migrierte, alt und jung … Sie feierten zusammen mit Kardinal Arns ihren »Heiligen«- eine ganze Kathedrale voller Armer betete, sang, skandierte Texte.
Bei der Kollekte fiel mir eine alte Frau auf, die vor mir stand, gebeugt, barfuß, in Lumpen gekleidet. Sie ging nach vorne und warf ihre Spende in den Korb. Da habe ich mich gefragt: »Und was gibst du von dir?«
Ich spürte, dass mich mein Weg in eine neue Richtung führen wollte, dass dieser Gott mehr will als ein soziales Jahr, dass er mich um alles bittet, um mir alles zu geben. Und so habe ich »Ja« gesagt. Ein Ja, das mein Leben veränderte.
Monate später begann für mich die Ausbildungszeit zur Vorbereitung auf die Gelübde der Armut, des Gehorsams und der Ehelosigkeit, die ich 1994 in Piacenza ablegte. In diesen Jahren konnte ich vor allem auch die Welt der Migrierten, meine Gemeinschaft und die scalabrinianische Spiritualität besser kennen lernen. Bald schon zog ich um in unsere kleine Gemeinschaft nach Rom. An der Universität Gregoriana konnte ich meine theologischen Kenntnisse erweitern und gleichzeitig arbeitete ich im Studienzentrum für Migration (CSER) der Scalabrini-Missionare. Mit Dankbarkeit schaue ich zurück auf die Zusammenarbeit mit vielen von ihnen. Sie haben nicht nur den ersten meiner Gemeinschaft das Leben und Wirken von Bischof Scalabrini nähergebracht, sondern waren auch für mich - vor allem in der monatelangen Vorbereitung der Seligsprechung Scalabrinis, bei der ich mitarbeiten durfte - ein großes Vorbild.
Nach einigen Jahren in Rom kam ich in unsere Gemeinschaft nach Solothurn in die Schweiz, wo ich heute lebe. Den großen Fragen, die mich schon als Jugendliche beschäftigten, spüre ich heute gemeinsam mit vielen jungen Menschen im IBZ-Scalabrini, aber auch in der Pädagogischen Hochschule und in der Firmpastoral in Solothurn, nach: Was macht mein Leben jeden Tag neu sinnvoll? Wie können wir in unserer Verschiedenheit in Frieden zusammenleben?
Der Traum von Bischof Scalabrini fasziniert mich dabei immer mehr: Aus allen Völkern entsteht eine einzige Menschheitsfamilie – langsam, nicht ohne Mühsal, aber unaufhaltsam. Zusammen mit Menschen aus der Schweiz, aus Eritrea und Äthiopien, Syrien und Afghanistan, dem Irak und dem Iran, Nicaragua und Brasilien, Algerien und der Ukraine, Burundi und Tibet, ja, aus der ganzen Welt darf ich im Internationalen Bildungszentrum - Scalabrini in Solothurn an diesem Traum mitarbeiten.
Ähnliche Blogartikel

11.03.2025
Città del Messico
Internationalen Bildungszentren, Migration, Lebensberichte
Jedes Land ist mein Land...
Nach mehreren Jahren in Deutschland kehrte Claudia, Mitglied unseres Scalabrini-Säkularinstituts, im August 2024 nach Mexiko-City zurück. Ist das eine »Rückkehr« in ihre »Heimat« oder ein Neuaufbruch? Sie erzählt von ihrer Erfahrung.
Weiterlesen
15.10.2024
Vietnam
Migration, Lebensberichte
Reisenotizen
Marina, die zurzeit zusammen mit Bianca und Marianne in Vietnam lebt, erzählt von einer Reise, die sie ins zentrale Hochland Vietnams führte. So konnte sie den Hintergrund vieler junger Binnenmigrantinnen und -migranten, die in Ho Chi Minh City wohnen, kennenlernen.

01.09.2024
Agrigento
Junge Erwachsene, Migration, Lebensberichte
Eine ganze Welt entdecken!
Emanuela ist neunzehn Jahre alt und wurde in Aarau (CH) als Kind italienischer Eltern geboren. Vor Beginn ihres Architekturstudiums verbrachte sie zehn Tage in unserer Gemeinschaft in Agrigent (Sizilien). Hier berichtet sie uns von ihren Erfahrungen.
Weiterlesen